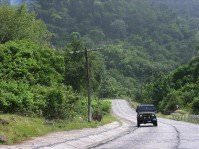Humanitäre Cuba Hilfe e.V.
Medizinische Hilfslieferungen, humanitäre, kulturelle
und politische Projekte, Informationsarbeit
www.hch-ev.de


HCH: Humanitäre Cuba
Hilfe
- ein Stück menschlicher Solidarität
jenseits politischen Kalküls und ideologischer Starre, Begegnungen zwischen
Menschen -
Kubas grünes Projekt
Reformierte Landwirtschaft:
Ausweitung der Nutzfläche, Fokussierung auf
Familienbetriebe,
ökologischer Anbau und urbane Gemüseproduktion
Von Peter ClausingAm 16. März 2010 verstörte eine Meldung mit der Überschrift »Kuba schließt 100 Agrarunternehmen« die Leser. Während sich jW auf diese Meldung beschränkte, beeilten sich andere Medien hinzuzufügen, daß Kuba 60 bis 70 Prozent seiner Nahrungsmittel importieren müsse. Präsident Raúl Castro suche nach »Rezepten«, um die landwirtschaftliche Produktion zu steigern. Derartige Meldungen entkoppeln die Fakten vom Kontext, zeichnen ein einseitiges Bild und ignorieren die Tatsache, daß die gesuchten »Rezepte« längst praktiziert werden. Die Mitteilung, daß 100 Betriebe geschlossen werden sollen und 40000 Beschäftigte einen neuen Job finden müssen, kam vom kubanischen Landwirtschaftsminister, Ulises Rosales del Toro, der Mitte März in Villa Clara an der Plenarsitzung des 10. Provinz-Kongresses des Nationalen Kleinbauernverbandes teilnahm.
Während von progressiven Agrarwissenschaftlern
die kubanische Landwirtschaft als erfolgreiches Experiment gepriesen
wird, veröffentlichte Dennis Avery im April 2009 einen Artikel mit
dem Titel »Cubans Starve on a Diet of Lies« (Die Kubaner verhungern
an einer Nahrung aus Lügen), der von politischen Gegnern des Landes
begierig aufgegriffen und im Internet verbreitet wurde. Avery ist
Direktor des Center for Global Food Issues am Hudson Institute in
Washington, einer konservative Denkfabrik, die unter anderem von
Firmen wie Monsanto, Syngenta und Cargill finanziert wird. In seiner
Veröffentlichung behauptet Avery, daß die kubanische Lebensmittelversorgung
nach wie vor zu über 80 Prozent von Importen abhängen würde und
daß die Erfolgsgeschichte des biologischen Anbaus in Kuba eine »große
kommunistische Lüge« sei.
Deutliche Steigerungsraten
Die Statistik der Welternährungsorganisation (FAO), die aktuell bis zum Jahr 2005 reicht, spricht eine andere Sprache. Bei den wichtigsten Grundnahrungsmitteln lag die Eigenproduktion in den Jahren 2002 bis 2005 um das Zwei- bis Dreifache höher als im Durchschnitt der Jahre 1991 bis 1994 der Sonderperiode nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Wirtschaftsraums. Diese Steigerungsraten betreffen sowohl die wichtigsten Getreidearten (Reis, Mais) als auch stärkehaltige Wurzelfrüchte (Kartoffel, Süßkartoffel, Maniok). Daten zu einzelnen Fruchtarten für 2006 und 2007 lassen eine weiteres Wachstum der Selbstversorgung erkennen und die Erntevorhersagen der FAO für 2009 sprachen von einer Rekordernte für Reis sowie überdurchschnittlichen Erträgen bei Mais.
Eine Gruppe von Autoren, die sich unter Federführung des kubanischen Agrarökologen Fernando Funes die Mühe gemacht haben, die von Avery in die Welt gesetzten Fehlinformationen zu zerpflücken, verweisen darauf, daß von 1996 bis 2005 die Pro-Kopf-Produktion bei Nahrungsmitteln insgesamt um jährlich 4,2 Prozent gesteigert wurde. Die tägliche Kalorienversorgung war in den kritischsten Jahren der Sonderperiode auf 2300 bis 2400 Kilokalorien (kcal) pro Person abgesunken, und die Kubaner hatten im statistischen Mittel neun Kilogramm an Körpergewicht verloren. Seit 2002 werden die Werte der 80er Jahre übertroffen und liegen seither auf über 3200 kcal pro Person und Tag. Die Kalorien aus tierischen Produkten blieben dabei im Bereich von 300 bis 400 kcal in den 80er Jahre lagen sie bei über 600 kcal. Statt dessen kommt der Gesundheit der Bevölkerung zugute, daß heute der Durchschnittskubaner täglich 800g Obst und Gemüse verzehrt (verglichen mit sieben Gramm pro Person und Tag im Jahr 1993).
Nachdem durch das Verschwinden des sozialistischen Lagers faktisch über Nacht sowohl die Exporteinnahmen als auch die Versorgung des Landes mit Erdöl, chemischen Düngemitteln und Pestiziden weggebrochen war, durchlief Kuba zunächst unfreiwillig eine »grüne Revolution«, die diesen Namen tatsächlich verdient. Im Gegensatz zur allgemein bekannten »Grünen Revolution«, die eigentlich eine agrochemische und Exportrevolution darstellte, setzt die kubanische Umwälzung auf Biolandbau und lokale Produktion. Der Erfolg dieser Entwicklung, die wie bei Revolutionen üblich nicht ohne Widersprüche verläuft, ist der Förderung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, dem hohen Bildungsniveau in Kuba (verbunden mit flächendeckenden Kampagnen), und einem Programm zur urbanen Landwirtschaft zu verdanken.
Die Hälfte der heute rund 200000 bäuerlichen
Familienbetriebe betreibt biologischen Anbau. Insgesamt werden von
diesen Betrieben auf nur 25 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche
mehr als 65 Prozent der nationalen Produktion erzeugt. Mit dem im
Juli 2008 verabschiedeten »Gesetz 259« ermöglichte die Regierung
Familien, die in die Landwirtschaft wechseln wollen, die Bewirtschaftung
von bis zu 13,42 Hektar Land. Inzwischen wurden rund 100000 Landnutzungsanträge
eingereicht. Das Ziel ist die agroökologische Bewirtschaftung von
1,5 Millionen Hektar, womit die Insel nach Schätzungen von Agrarwissenschaftlern
den Status der vollen Ernährungssouveränität erreichen könnte. Außerdem
verfügt Kuba über ausreichend Landreserven, die urbar gemacht werden
können. Laut FAO wurde von 2008 zu 2009 die landwirtschaftlich genutzte
Fläche um 30 Prozent erhöht, und die Regierung beabsichtigt, die
Reis- und Bohnenimporte innerhalb der nächsten fünf Jahre zu halbieren.
Urbane Landwirtschaft
Eine der bemerkenswertesten Entwicklungen
sind die 50000 Hektar urbaner Landwirtschaft, auf denen jährlich
über 1,5 Millionen Tonnen Obst und Gemüse erzeugt werden. Etwa 380000
Kubaner beteiligen sich an diesem Projekt. Die Spitzenerträge liegen
bei 20 Kilogramm eßbarer Produkte pro Quadratmeter, und Städte wie
Havanna und Santa Clara versorgen sich bei Gemüse zu über 70 Prozent
aus eigener Produktion. Das geschieht nahezu ohne Verbrauch an fossilen
Energieträgern, die in anderen Ländern für Transport, Landmaschinen,
Düngemittel und Pestizide verpulvert werden. Im Zuge der Überwindung
der kritischen Phase der »Sonderperiode« in den 90er Jahren wurde
Kuba zum Musterland nachhaltiger landwirtschaftlicher Produktion.
Innerhalb eines Jahrzehnts erfolgte die Konversion eines hochspezialisierten,
exportorientierten Landwirtschaftsmodells, das massiv von importierten
chemischen Inputs abhing, in ein Modell, das in großem Maßstab auf
agroökologischen Prinzipien basiert. Hier wird biologischer Anbau
nicht zertifiziert. Es geht nicht darum, über Ökolabels Vorteile
auf dem Weltmarkt zu erhaschen, sondern um die Sicherung der Ernährung
eines ganzen Landes mit einer diversifizierten Produktion, die selbst
unter den ungünstigen klimatischen Bedingungen von Hurrikans eine
bemerkenswerte Elastizität aufweist. Ohne daß bislang weitere Details
bekannt sind, könnte die oben erwähnte Ankündigung, 100 ineffiziente
Agrarunternehmen schließen zu wollen, auf eine weitere Stärkung
des Biolandbaus hindeuten.
Streit um Gentechnik
Die Erfolgskurve der ökologischen Landwirtschaft in Kuba kam weder von selbst noch verläuft die landwirtschaftliche Entwicklung ohne Widersprüche. Der Agrarökologe Fernando Funes verwies unlängst darauf, daß es in Kuba nach wie vor kein in sich geschlossenes Programm zur Förderung des biologischen Anbaus gibt, machte aber zugleich deutlich, daß die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der vergangenen zwanzig Jahre für die Ausbreitung biologischer Anbaumethoden sehr förderlich waren.
Zu den Widersprüchen zählt ferner die Tatsache,
daß sich ein Teil der landwirtschaftlichen Produzenten die konventionellen
Anbaumethoden zurückwünschen. Auch die Entwicklung gentechnisch
veränderter Sorten zählt zu den Widersprüchen. Im Februar 2009 trat
das Zentrum für Gentechnik und Biotechnologie (CIBG) in Havanna
mit der Meldung an die Öffentlichkeit, daß erstmalig in Kuba drei
Hektar mit Genmais bepflanzt worden seien von besserer Resistenz
gegen den Erreger Palomilla del maíz und erhöhter Toleranz gegen
Pestizide war die Rede. Die Debatte zu diesem Thema ist inzwischen
entbrannt: Die Vorstellung des kritischen Buches »Genmanipulationen.
Was gewinnen wir? Was verlieren wir?« von F.R. Funes-Monzotes erwies
sich als Publikumsmagnet auf der diesjährigen Buchmesse in Havanna.
Unser Autor
ist promovierter Agrarwissenschaftler und lebt in Potsdam
junge Welt, 5. Mai 2010